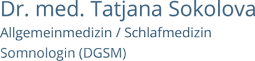Schlafmedizin
Warum brauchen wir überhaupt Schlaf?

Wir alle wissen: Eine schlechte Nacht verdirbt den nächsten Tag. Schlafen wir unruhig oder zu kurz, sind wir tagsüber unkonzentriert, unproduktiv und reizbar. Wird der Schlafmangel zur Regel, sind wir wesentlich anfälliger für Stress und Krankheiten.
Das liegt daran, dass unser Körper, während wir scheinbar untätig im Bett liegen, lebensnotwendige Wartungsarbeiten verrichtet. Im Schlaf wird unser Immunsystem aktiv. Jetzt werden die Krankheitserreger angegriffen, die wir uns tagsüber eingefangen haben und Antikörper gebildet. Das erklärt auch, warum wir manchmal den ganzen Tag durchschlafen, wenn wir krank sind: Unser Körper verordnet lange Schlafphasen, damit das Immunsystem Zeit hat, die Infektion zu bekämpfen.
Im Schlaf produziert unser Körper Hormone, die die Wundheilung, die Zellregeneration und das Wachstum anregen und den Blutdruck regulieren. Auch unsere Verdauung ist aktiv während wir schlafen. Idealerweise sollten wir vier Stunden vor dem Zubettgehen nichts mehr essen, denn dann ist die Vorverdauung der letzten Mahlzeit bereits abgeschlossen und wir können ungestört schlafen, während unser Darm die Endverdauung übernimmt.
Aber auch unser Kopf ist im Schlummer keineswegs untätig. Sicher haben Sie schon einmal erlebt, dass Ihnen die Ereignisse des Tages in Ihre Träume folgen und Sie nachts einen unvollendeten Streit fortsetzen oder eine Prüfung absolvieren, die Ihnen im wirklichen Leben erst noch bevorsteht. Welche Funktion Träume genau erfüllen und warum wir überhaupt träumen, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass unser Gehirn im Schlaf, besonders während der sogenannten REM-Phase (Siehe: “Die Schlafphasen”) unser Gehirn damit beschäftigt ist, die Ereignisse des Tages und die neu erworbenen Informationen zu ordnen.
Die über den Tag gesammelten Sinneseindrücke, die im Hippocampus, dem Kurzzeitspeicher des Gehirns, gelandet sind, werden dabei in den Neokortex, also in unser Langzeitgedächtnis, transferiert. Dabei werden die neuen Informationen mit bereits abgespeicherten Erinnerungen verknüpft. Was wichtig ist, wird in den Langzeitspeicher aufgenommen, unwichtige Informationen werden gelöscht. Dieser Vorgang ist nur dann ungestört möglich, wenn nicht gleichzeitig neue Sinneseindrücke einströmen. Deshalb sind wir ohne guten und ausreichenden Schlaf langfristig nicht in der Lage, gelerntes Wissen zu behalten und effektiv abzurufen.
Es hat also einen guten Grund, dass uns vor einer wichtigen Entscheidung oft geraten wird, wir sollten erst einmal “eine Nacht drüber schlafen”, denn erst im Schlaf können neue Informationen richtig verarbeitet, abgewogen und effektiv mit unserem bereits vorhandenen Wissen verknüpft werden.
Chronischer Schlafmangel und seine Folgen

Ein Viertel der erwachsenen Deutschen schläft nur 6 Stunden pro Nacht, viele bekommen noch deutlich weniger Ruhe. Wir neigen als Gesellschaft dazu, Schlafmangel zu normalisieren oder ihn sogar als Zeichen besonderer Leistungsfähigkeit zu betrachten. Journalisten befragen erfolgreiche Unternehmer und Politikerinnen gerne zu ihren Schlafgewohnheiten und stellen einen impliziten Zusammenhang her zwischen Erfolg im Beruf und einem “effektiven” Umgang mit Schlaf, bei dem die Schlafenszeit auf 5 Stunden oder weniger pro Nacht reduziert wird. Für zu viele von uns ist ausreichender Schlaf etwas, das sich scheinbar nicht mit dem Arbeitsalltag vereinbaren lässt, sondern am Wochenende oder im Urlaub “nachgeholt” werden muss. Dabei ist längst belegt, dass chronischer Schlafmangel gefährliche Folgen für unsere Gesundheit hat und dass sich diese nicht durch gelegentliches Ausschlafen am Wochenende kompensieren lassen.
Schlafmangel zerstört nicht nur unsere kognitive Leistungsfähigkeit, sondern kann auch zu Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen und einem erhöhten Krebsrisiko führen. Menschen, die dauerhaft zu wenig schlafen, neigen stärker zu Übergewicht, da durch Schlafmangel das Belohnungssystem in unserem Gehirn durcheinander gerät und uns veranlasst, uns geistesabwesend kalorienreiche Nahrung zuzuführen.
Neben solchen langfristigen Folgen ist Schlafmangel auch für eine große Zahl von tödlichen Autounfällen verantwortlich, verursacht durch mangelnde Konzentration beim Fahren oder den berühmten “Sekundenschlaf”, bei dem der erschöpfte Fahrer für wenige Sekunden am Steuer eingenickt.
Nichtsdestotrotz gibt es keine allgemeingültige Menge an Schlaf, die für alle Menschen ideal ist. Während 7 Stunden pro Nacht als ein gesunder Durchschnitt gilt, gibt es auch Menschen, die dauerhaft sehr gut mit weniger Schlaf auskommen und dabei gesund und leistungsfähig bleiben. Wieder andere müssen regelmäßig 8 Stunden oder länger schlafen, um sich erholt zu fühlen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse genetisch bedingt sind. Ebenso entscheiden unsere Gene darüber, ob wir “Nachteulen” sind, die am liebsten erst tief in der Nacht schlafen gehen und den nächsten Vormittag verschlafen, oder “Lerchen”, die lieber früh zu Bett gehen und schon in den frühen Morgenstunden aktiv sind.
In vielen Berufen und an unseren Schulen ist ein Arbeitsrhythmus vorgegeben, der eher den Lerchen unter uns entgegenkommt, als den Eulen. Besonders für viele Jugendliche ist ein sehr früher Schulbeginn kontraproduktiv, denn die Pubertät beeinflusst ihre innere Uhr (Siehe: “Die innere Uhr”). Sie benötigen mehr Schlaf, als Erwachsene, werden aber Abends erst spät müde. Deshalb wird in den letzten Jahren verstärkt über einen späteren Schulbeginn diskutiert. Besonders Eulen leiden unter den Nachteilen des stetigen Lebens gegen die angeborene innere Uhr. Wenn zum Beispiel die Eule frühmorgens in der Schule oder im Beruf Leistung erbringen soll, während die innere Uhr noch Schlafenszeit signalisiert, kommt es zum sogenannten „sozialen Jetlag“: Die biologische und die soziale Uhr sind im Widerstreit. Nach ersten Studien kann dies auf Dauer auch zu Übergewicht, Diabetes, Depressionen, Alkoholismus und Auswirkungen auf das Immunsystem führen, da es stets zur „falschen“ Zeit aktiviert wird.
Noch viel schwerwiegender sind die Auswirkungen unseres Arbeitsalltags auf den Schlaf aber für Schichtarbeiter. Besonders der Wechsel zwischen Spät- und Frühschichten macht Schichtarbeiter auf Dauer deutlich krankheitsanfälliger, als Menschen mit geregelter Arbeitszeit.
Abends nach Einbruch der Dunkelheit zu Bett zu gehen und mindestens bis zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen durchzuschlafen, erscheint uns in Deutschland als normal und die wenigsten von uns nehmen sich tagsüber regelmäßig Zeit für Schlafpausen. Dabei ist dieser Schlafrhythmus, bei dem wir unseren gesamten Schlaf in den Nachtstunden bündeln, ein relativ neues Phänomen.
In der vorindustriellen Zeit, war das Schlafen in mehreren Abschnitten, verteilt über Tag und Nacht, viel verbreiteter. Wer Tiere zu versorgen hatte, musste oft schon im Morgengrauen aufstehen und einige Stunden Arbeit verrichten, konnte sich dann aber auch mitten am Tag wieder für ein paar Stunden ins Bett legen.
Erst mit der Industrialisierung lernte der Mensch, in der Nacht effizient zu schlafen, um tagsüber in Fabriken und Geschäften arbeiten zu können.
Schlafen gehen & Einschlafen
Die Schlafphasen

Wenn wir eine erholsame Nacht beschreiben, sagen wir gerne, dass wir “tief und fest” geschlafen haben. Tatsächlich liegt aber auch der gesündeste Schläfer nicht stundenlang in tiefstem Schlaf, sondern erlebt jede Nacht einen Wechsel aus verschiedenen Schlafphasen.
Vereinfacht gesprochen können wir drei Schlafphasen unterscheiden: den Leichtschlaf, den Tiefschlaf und den REM-Schlaf. Diese drei Phasen bilden zusammen jeweils einen Schlafzyklus von etwa 90 Minuten. In einer durschnittlichen Nacht, durchleben wir etwa 4-6 solcher Zyklen.
In den ersten beiden Zyklen gehen wir vom Leichtschlaf in den Tiefschlaf, dann wieder in den Leichtschlaf und anschließend in den REM-Schlaf über. In den folgenden Zyklen entfällt die Tiefschlafphase und Leichtschlaf und REM-Schlaf wechseln sich ab.
Der Schlaf beginnt mit der Einschlafphase, in der wir von einem müden Wachzustand in den Schlaf hinübergleiten. Diese Phase kann zwischen wenigen Minuten und etwa einer halben Stunde andauern. In dieser Phase entspannt sich unser Körper aber manchmal kommt es zu plötzlichen Zuckungen, die uns wieder aus dem Dämmerschlaf reißen. Verbreitet ist in dieser Phase auch das Gefühl des plötzlichen Fallens, das uns ebenfalls hochschrecken lässt. Die Ursachen für diese “Einschlafzuckungen” sind von der Wissenschaft noch nicht vollständig geklärt, man nimmt aber an, dass ein neurologischer Konflikt dahinter steckt, bei dem ein Teil unseres Gehirns Signale zum Einschlafen sendet, während ein anderer Teil noch wachsam ist. Es wird zudem vermutet, dass der Konsum von Koffein, vor allem spät am Tag, “Einschlafzuckungen” begünstigt.
Quelle
Sind wir einmal eingeschlafen, erleben wir zunächst eine Leichtschlaf-Phase, bevor wir in die erste Tiefschlaf-Phase fallen. In den Tiefschlaf-Phasen ist unsere körperliche Aktivität auf ein Minimum reduziert. In dieser Phase der körperlichen Regeneration ist unser Immunsystem besonders aktiv und unser Körper stößt Wachstumshormone aus (siehe “Wozu brauchen wir eigentlich Schlaf?”)
In den REM-Phasen ist unser Körper vollkommen entspannt, unser Gehirn arbeitet aber auf Hochtouren. Kennzeichnend für die REM-Phase ist unter anderem, dass sich unsere Augen unter unseren geschlossenen Lidern schnell hin- und her-bewegen. Die Bezeichnung REM steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. In dieser Phase arbeitet unser Gehirn daran, die Eindrücke des Tages zu verarbeiten und zu sortieren. (Siehe “Warum brauchen wir überhaupt Schlaf”) Damit dieser Prozess ungestört ablaufen kann, blendet unser Gehirn sämtliche äußeren Reize aus, weshalb es auch besonders schwer ist, einen schlafenden Menschen in dieser Phase zu wecken. In der REM-Phase haben wir oft besonders lebhafte, emotionale und absurde Träume.
Zum Ende der Schlafzyklen beginnt die Aufwachphase. Dabei kommt es nicht selten vor, dass wir schon mehrere Stunden bevor unser Wecker klingelt aufwachen aber noch einmal einschlafen. Zwar können wir noch ein paar Stunden Schlaf genießen, unser Körper befindet sich aber längst nicht mehr in dem ruhigen Zustand der frühen Tiefschlafphasen, sondern fährt langsam hoch, um für den nächsten Tag bereit zu sein. Körpertemperatur, Herzfrequenz und Kortisolspiegel steigen in dieser Zeit an. Unser Magen wird stärker durchblutet und wir beginnen, Hunger zu verspüren. Diese Aktivitäten erleichtern uns das Aufwachen, wenn es Zeit ist, unseren Tag zu beginnen, da wir unseren Körper nicht aus der tiefsten Entspannung reißen müssen. Trotzdem brauchen die meisten von uns morgens noch einige Zeit, um den Schlaf vollständig abzuschütteln.
Die innere Uhr
Wer schon einmal in wechselnden Schichten gearbeitet oder mit dem Flugzeug mehrere Zeitzonen durchquert hat weiß, dass es nicht einfach ist, unseren gewohnten Schlafrhythmus zu durchbrechen. Dies liegt an der sogenannten “inneren Uhr”, die bestimmt, wann unser Körper und Gehirn aktiv sind und wann sie sich in den Erholungsmodus begeben. Am besten funktioniert die innere Uhr, wenn wir uns an regelmäßige Schlafenszeiten halten und von Tag zu Tag nicht mehr als 30 Minuten von unseren gewohnten Zeiten des Zubettgehens und Aufstehens abweichen.
Das Steuerungszentrum unserer “innere Uhr” befindet sich in einer etwa erbsengroßen Region des Zwischenhirns, dem suprachiasmatischen Nucleus (SCN). Von hier aus werden Signale in anderen Gehirnregionen geschickt, die wiederum die Aktivitäten der Organe steuern, indem sie Nervenreize oder Hormone durch den Körper senden. Dabei werden den Organen zu verschiedenen Zeiten Phasen der Ruhe und der Aktivität erlaubt. So ist beispielsweise das Kurzzeitgedächtnis am späten Vormittag besonders aktiv, weshalb wir zu dieser Zeit komplexe Denkaufgaben besonders gut lösen können. Ist ein Organ besonders beschäftigt, wie etwa der Magen während der Verdauung des Mittagessens, kann es zu Ermüdungserscheinungen in anderen Teilen des Organismus kommen.
Der individuelle Rhythmus der “inneren Uhr” ist bei jedem Menschen anders, wird jedoch über den Einfall von Tageslicht reguliert und dadurch an unseren 24-Stunden-Tag angepasst. Wichtig ist dabei das Hormon Melatonin. Dieses wird bei Dunkelheit in einer kleinen Drüse, der sogenannten Zirbeldrüse, in unserem Gehirn gebildet und befördert das Einschlafen. Die Produktion von Melatonin wird aber nicht nur durch nächtlichen Lichtmangel angestoßen - in den dunklen Herbst- und Wintertagen kann der Melatoninspiegel unabhängig von der Tageszeit ebenfalls ansteigen.
Über den Einfall von Licht kann die innere Uhr sich bei einer Störung des gewohnten Rhythmus neu ausrichten, was z.B. bei einer Reise in eine andere Zeitzone nötig wird. Jedoch nimmt diese Anpassung oft mehrere Tage in Anspruch, eine Phase, die als “Jetlag” bekannt ist.
Schon eine kurzfristige Änderung des Schlafrhythmus kann unsere innere Uhr durcheinander bringen. Das erleben z.B. Menschen, die am Wochenende gerne später zu Bett gehen und länger schlafen, als unter der Woche. Am Montagmorgen fällt es ihnen dann besonders schwer, sich wieder auf den Rhythmus der Woche einzustellen und sie erleben zu Beginn der Woche ein Stimmungstief und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.
Besonders drastisch wirkt sich ein ständiger Wechsel der Schlafens- und Wachzeiten aus, wie er z.B. bei Schichtarbeitern der Fall ist. Arbeit in wechselnden Schichten bedeutet, dass man regelmäßig zu Zeiten arbeiten muss, in denen die innere Uhr auf Ruhe eingestellt ist und ausruhen, wenn die innere Uhr uns signalisiert, dass wir Leistung erbringen sollten. Auch bei dauerhafter Nachtarbeit kann sich die innere Uhr nicht komplett anpassen. Schichtarbeiter leiden deshalb oft unter chronischen Schlafstörungen.
Doch auch wer zu “normalen” Zeiten arbeitet, lebt oft nicht im Einklang mit dem natürlichen Schlafrhythmus. Ob wir Morgenmenschen (Lerchen) oder Nachtmenschen (Eulen) sind ist genetisch bedingt. Wissenschaftler sprechen hier von unserem “Chronotyp”. Wer als “Eule” jeden Morgen früh mit der Arbeit beginnen muss und möglicherweise auch noch einen langen Arbeitsweg hat, zwingt sich dauerhaft, entgegen des natürlichen Rhythmus zu leben. Forschungen u.a. an der Ludwig-Maximilians Universität in München haben ergeben, dass ein Leben entgegen unseres Chronotypes uns langfristig in einen Zustand versetzt, den Professor Till Roenneberg den “sozialen Jetlag” nennt. (Siehe: “Chronischer Schlafmangel und seine Folgen”)
Schlafstörungen
Schlafstörungen manifestieren sich auf unterschiedliche Art und Weise. Einige der häufigsten Störungen sind:
Diagnostik
In der Schlafmedizin erfolgt die Diagnostik als Stufendiagnostik nach den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin.
Therapie
Auch die Therapie erfolgt in Stufen. An erster Stelle stehen dabei immer nichtmedikamentöse Therapieform, z.B. Schlafhygiene. Kann die Schlafstörung damit in den Griff bekommen werden, kommen andere Mittel zum Einsatz.
Schlafhygiene
Regelmäßigkeit. Gehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie morgens um die gleiche Zeit auf, um die biologischen Rhythmen des Körpers aufeinander abzustimmen.
Essen & Trinken. Essen Sie drei Stunden vor dem Schlafengehen keine größeren Mengen. Gehen Sie aber auch nicht hungrig zu Bett. Trinken Sie drei Stunden vor dem Schlafengehen keinen Alkohol und vier bis acht Stunden vor dem Schlafengehen keine koffeinhaltigen Getränke.
Schlafdruck. Schlafen Sie mittags nicht länger als 15 Minuten, ansonsten verringert sich der Schlafdruck am Abend.
Grübeln. Versuchen Sie ihre Probleme nicht ins Bett zu nehmen. Dafür können sie Entspannungstechniken lernen (z.B. Meditation, Atemübungen usw.). Mittlerweile gibt es viele Apps, die Sie dabei unterstützen können.
Sport. Sportliche Aktivitäten gehören nicht in die Abendstunden, da sie die Körpertemperatur erhöhen und wir zum Einschlafen eine niedrige Körpertemperatur benötigen.
Schlafzimmer. Gestalten Sie Ihre Schlafumgebung angenehm. Fernseher gehören nicht ins Schlafzimmer. Am besten schläft man mit viel frischer Luft und einer Raumtemperatur von 18 Grad. Vielen Menschen hilft auch eine Schlafbrille.
Computer & Handy. Versuchen Sie, zwei Stunden vor dem Schlafengehen keine Geräte mit Hintergrundbeleuchtung zu benutzen. Ihr Licht hält das Gehirn wach.
Nicht einschlafen können. “Der Schlaf ist wie eine Taube: Streckt man die Hand ruhig nach ihr aus, setzt sie sich drauf. Greift man nach ihr, fliegt sie weg.”
Für Sie heißt das: Wenn Sie merken, dass sie nicht einschlafen können, versuchen Sie es nicht mit aller Kraft, sondern stehen Sie auf und verlassen Sie das Bett. Bügeln Sie, stricken Sie, lesen Sie ein Buch - erst wenn Sie müde sind, legen Sie sich wieder ins Bett.
Machen Sie sich klar, dass es keine Tragödie ist, selbst wenn Sie eine Nacht nicht schlafen können.
Die Uhr. Wenn Sie nicht einschlafen können, oder nachts aufwachen, schauen Sie nicht auf die Uhr. Ihr Wecker ist gestellt und Sie werden nicht verschlafen. Alles andere ist jetzt unwichtig.
Schlafmittel
Die wohl bekannteste Art, Schlafstörungen zu bekämpfen, ist die Einnahme von Schlafmitteln. Viele Patienten sind dieser Therapie gegenüber skeptisch, da Schlafmitteln zurecht Suchtpotential nachgesagt wird. Früher wurden als Schlafmittel auch Benzodiazepine eingesetzt. Heute wissen wir, dass diese schnell zu starker Abhängigkeit und auch zu gefährlichen Nebenwirkungen führen.
Neuere Z-Substanzen sind zwar weniger gefährlich aber nicht unproblematisch, weshalb auch diese rezeptpflichtig sind und nur in Absprache mit einem Arzt, idealerweise einem Schlafmediziner, eingenommen werden sollten.
Eines ist klar: Schlafmittel behandeln das Symptom, nicht die Ursache. Sollten ihre Schlafstörungen länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie unbedingt einen Schlafmediziner aufsuchen, damit sie nicht chronisch werden. Denn: chronische Schlafstörungen sind viel schwieriger zu behandeln!
Insgesamt gilt es stets, die potentiellen Nebenwirkungen gegen die Auswirkungen der Schlafstörung abzuwägen. Denn es ist erwiesen, dass unbehandelte Schlafstörungen sich stark auf die kognitiven Fähigkeiten und die Reaktionszeit auswirken, was für Betroffene nicht nur unangenehm ist, sondern in bestimmten Situationen, etwa im Straßenverkehr, lebensgefährlich sein kann. Schlafmediziner haben neben Schlafmitteln ein großes Arsenal weiterer Medikamente, die Schlafstörungen beseitigen können aber kein Suchtpotenzial haben.
Überdrucktherapie ("Maske")
Es gibt verschiedenste Atmungsstörungen im Schlaf. Am bekanntestens ist die Schlafapnoe (Schnachen und Atemaussetzer). Diese kann oft mithilfe eines CPAP-Geräts behandelt werden. Dabei handelt es sich um eine Atemtherapiemaske, die nachts getragen wird und durch kontinuierliche Luftzufuhr hilft, die Atemwege offen zu halten.
Im Schlaflabor kann dieses Gerät auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst und eingestellt werden.
Unterkiefer-Protrusionsschiene
Die Unterkieferprotrusionsschiene besteht aus je einer transparenten Schiene für den Oberkiefer und den Unterkiefer. Diese Schienen sind mit zwei schmalen Stegen miteinander verbunden und ziehen den Unterkiefer leicht nach vorne. Das sorgt dafür, dass die Atemwege sich weniger verengen können und die Luft mit weniger Kraft und Geschwindigkeit geatmet werden kann. Dies unterbindet das Flattern (Schnarchen) der Weichteile. Weil die Schiene elastisch ist, bleiben Kieferbewegungen möglich.
Weil die Wirkung der Überdrucktherapie (CPAP) sicher ist, werden die Kosten für eine Unterkiefer-Protrusionsschiene nur dann von den Kassen übernommen, wenn eine Überdrucktherapie nicht vertragen wird.
Hypoglossus-Stimulation
Die Hypoglossus-Stimulation ist ein relativ neues Verfahren zur Behandlung von Atembeschwerden im Schlaf (sog. obstruktiven Schlafapnoe). Dabei wird eine Stimulationselektrode unter der Haut implantiert, die während des Schlafs einen Nerv (Nervus hypoglossus) stimuliert, der die Halsmuskeln strafft und dadurch die Atemwege freihält. Diese Therapie ist für Patienten geeignet, die unter einer mittleren bis schweren obstruktiven Schlafapnoe leiden, nicht signifikant übergewichtig sind, und bei denen die CPAP-Therapie nicht anwendbar ist oder nicht ausreichend erfolgreich war.
Unsere Praxis & Schlaflabor
Unsere Praxis wird von Frau. Dr. Sokolova geleitet, die als Somnologin bereits 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Schlafmedizin hat und mehrere Jahre das Schlaflabor einer Klinik geleitet hat. Wir verfügen über mehrere Polygraphen (Schlafspeicher) der neuesten Generation sowie als Mitgesellschafter über Betten im Zentralen Schlaflabor Berlin.