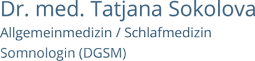Schlafmangel
Chronischer Schlafmangel und seine Folgen

Ein Viertel der erwachsenen Deutschen schläft nur 6 Stunden pro Nacht, viele bekommen noch deutlich weniger Ruhe. Wir neigen als Gesellschaft dazu, Schlafmangel zu normalisieren oder ihn sogar als Zeichen besonderer Leistungsfähigkeit zu betrachten. Journalisten befragen erfolgreiche Unternehmer und Politikerinnen gerne zu ihren Schlafgewohnheiten und stellen einen impliziten Zusammenhang her zwischen Erfolg im Beruf und einem “effektiven” Umgang mit Schlaf, bei dem die Schlafenszeit auf 5 Stunden oder weniger pro Nacht reduziert wird. Für zu viele von uns ist ausreichender Schlaf etwas, das sich scheinbar nicht mit dem Arbeitsalltag vereinbaren lässt, sondern am Wochenende oder im Urlaub “nachgeholt” werden muss. Dabei ist längst belegt, dass chronischer Schlafmangel gefährliche Folgen für unsere Gesundheit hat und dass sich diese nicht durch gelegentliches Ausschlafen am Wochenende kompensieren lassen.
Schlafmangel zerstört nicht nur unsere kognitive Leistungsfähigkeit, sondern kann auch zu Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen und einem erhöhten Krebsrisiko führen. Menschen, die dauerhaft zu wenig schlafen, neigen stärker zu Übergewicht, da durch Schlafmangel das Belohnungssystem in unserem Gehirn durcheinander gerät und uns veranlasst, uns geistesabwesend kalorienreiche Nahrung zuzuführen.
Neben solchen langfristigen Folgen ist Schlafmangel auch für eine große Zahl von tödlichen Autounfällen verantwortlich, verursacht durch mangelnde Konzentration beim Fahren oder den berühmten “Sekundenschlaf”, bei dem der erschöpfte Fahrer für wenige Sekunden am Steuer eingenickt. Nichtsdestotrotz gibt es keine allgemeingültige Menge an Schlaf, die für alle Menschen ideal ist. Während 7 Stunden pro Nacht als ein gesunder Durchschnitt gilt, gibt es auch Menschen, die dauerhaft sehr gut mit weniger Schlaf auskommen und dabei gesund und leistungsfähig bleiben. Wieder andere müssen regelmäßig 8 Stunden oder länger schlafen, um sich erholt zu fühlen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse genetisch bedingt sind. Ebenso entscheiden unsere Gene darüber, ob wir “Nachteulen” sind, die am liebsten erst tief in der Nacht schlafen gehen und den nächsten Vormittag verschlafen, oder “Lerchen”, die lieber früh zu Bett gehen und schon in den frühen Morgenstunden aktiv sind.
In vielen Berufen und an unseren Schulen ist ein Arbeitsrhythmus vorgegeben, der eher den Lerchen unter uns entgegenkommt, als den Eulen. Besonders für viele Jugendliche ist ein sehr früher Schulbeginn kontraproduktiv, denn die Pubertät beeinflusst ihre innere Uhr (Siehe: “Die innere Uhr”). Sie benötigen mehr Schlaf, als Erwachsene, werden aber Abends erst spät müde. Deshalb wird in den letzten Jahren verstärkt über einen späteren Schulbeginn diskutiert. Besonders Eulen leiden unter den Nachteilen des stetigen Lebens gegen die angeborene innere Uhr. Wenn zum Beispiel die Eule frühmorgens in der Schule oder im Beruf Leistung erbringen soll, während die innere Uhr noch Schlafenszeit signalisiert, kommt es zum sogenannten „sozialen Jetlag”: Die biologische und die soziale Uhr sind im Widerstreit. Nach ersten Studien kann dies auf Dauer auch zu Übergewicht, Diabetes, Depressionen, Alkoholismus und Auswirkungen auf das Immunsystem führen, da es stets zur „falschen” Zeit aktiviert wird.
Noch viel schwerwiegender sind die Auswirkungen unseres Arbeitsalltags auf den Schlaf aber für Schichtarbeiter. Besonders der Wechsel zwischen Spät- und Frühschichten macht Schichtarbeiter auf Dauer deutlich krankheitsanfälliger, als Menschen mit geregelter Arbeitszeit.
Abends nach Einbruch der Dunkelheit zu Bett zu gehen und mindestens bis zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen durchzuschlafen, erscheint uns in Deutschland als normal und die wenigsten von uns nehmen sich tagsüber regelmäßig Zeit für Schlafpausen. Dabei ist dieser Schlafrhythmus, bei dem wir unseren gesamten Schlaf in den Nachtstunden bündeln, ein relativ neues Phänomen.
In der vorindustriellen Zeit, war das Schlafen in mehreren Abschnitten, verteilt über Tag und Nacht, viel verbreiteter. Wer Tiere zu versorgen hatte, musste oft schon im Morgengrauen aufstehen und einige Stunden Arbeit verrichten, konnte sich dann aber auch mitten am Tag wieder für ein paar Stunden ins Bett legen.
Erst mit der Industrialisierung lernte der Mensch, in der Nacht effizient zu schlafen, um tagsüber in Fabriken und Geschäften arbeiten zu können.